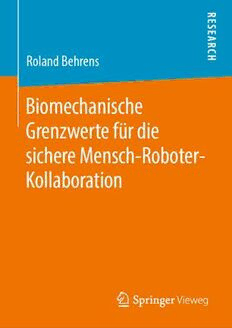Table Of ContentRoland Behrens
Biomechanische
Grenzwerte für die
sichere Mensch-Roboter-
Kollaboration
Biomechanische Grenzwerte für die
sichere Mensch-Roboter-Kollaboration
Roland Behrens
Biomechanische
Grenzwerte für die
sichere Mensch-Roboter-
Kollaboration
Mit einem Geleitwort von
Prof. Dr. techn. Robert Elkmann
Roland Behrens
Fraunhofer IFF
Geschäftsfeld Robotersysteme
Magdeburg, Deutschland
Dissertation TU Ilmenau, 2018
ISBN 978-3-658-26995-1 ISBN 978-3-658-26996-8 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-26996-8
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Vieweg
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen
etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die
Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des
Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und
Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt
sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Geleitwort
Die Leitung einer Abteilung an einem Fraunhofer-Institut ist mit
vielfältigen und sehr interessanten Aufgaben verbunden. Neben der
strategischen Aufstellung und der Setzung von Forschungsschwerpunk-
ten steht auch die Personalführung und -entwicklung im Vordergrund
der Aufgaben. Es ist sehr spannend zu beobachten, wie sich Personen
mit ihren Aufgaben entwickeln und Herausforderungen diese Personen
prägen. Im Falle von Roland Behrens hat es mir besondere Freu-
de bereitet, seine persönliche und fachliche Entwicklung über Jahre
hinweg begleiten zu können. Nach der Entscheidung im Jahr 2012,
umfangreiche Probandenversuche zu initiieren und durchzuführen,
um biomechanische Belastungswerte für eine sichere Mensch-Roboter-
Kollaboration in einem weltweit einmaligen Umfang zu ermitteln, hat
er sich dieser Aufgabe angenommen und mit beispiellosem Engage-
ment, Kreativität und Sachwissen umgesetzt.
Die Dissertation von Herrn Behrens behandelt ein sehr grundlagen-
orientiertes Forschungsthema mit großem Praxisbezug und Nutzen
für alle, die sich mit Robotik und Mensch-Roboter-Kollaboration be-
schäftigenbzw.RoboterapplikationenplanenoderfürdieRisikobewer-
tung solcher verantwortlich sind. Die Mensch-Roboter-Kollaboration
betrachtet den Fall, dass beim Einsatz eines Roboters auch Men-
schen berührt werden können. Dabei muss sichergestellt sein, dass
der Mensch nicht zu Schaden kommt. Das Ziel der Dissertation von
Herrn Behrens ist ein wissenschaftlich neuartiger und vom Studienum-
fang einzigartiger Vorstoß, um die Belastungsgrenzen in der Mensch-
Roboter-Kollaboration für die internationale Normung zu ermitteln,
den Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik fortzuschreiben und
dabei zukünftige Handlungs- und Forschungsbedarfe aufzuzeigen.
VI Geleitwort
Die Dissertation von Herrn Behrens zeichnet sich einerseits dadurch
aus, dass sie eine Vielzahl sehr anspruchsvoller Forschungsthemen
umfassend behandelt, und anderseits durch die Vollständigkeit und
dem effizienten Zusammenführen der Forschungsthemen. Im Ergebnis
liegen wissenschaftlich fundierte biomechanische Belastungsgrenzen
vor, die im weltweiten Maßstab eine Alleinstellung und Einzigartigkeit
aufweisen. Sie ermöglichen es allen Robotikern erstmalig, sichere Ro-
boterapplikationen ohne trennende Schutzeinrichtungen umzusetzen.
Magdeburg, im April 2019 Norbert Elkmann
Vorwort
Die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 2012 bis 2017. Ihr ging
ein intensiver Diskurs über Grenzwerte für sichere Mensch-Roboter-
Interaktionen voraus. Er mündete in der Einsicht, dass der damalige
wissenschaftliche Kenntnisstand nicht ausreicht, um zweckmäßige
Grenzwerte für die internationale Normung festzulegen. Diese Situati-
on veranlasste am 27. April 2012 meinen Chef Prof. Elkmann dazu,
am Fraunhofer IFF eine Probandenstudie zu initiieren, aus der die
gesuchten Grenzwerte hervorgehen sollten. Aus früheren Projekten
verfügte das Fraunhofer IFF bereits über eine geeignete Versuchsein-
richtung. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase konnten wir mit
denerstenProbandenversuchenbeginnen.UnsereAktivitätenweckten
schnelldasInteressederFirmenDaimlerundKUKA,diesichdankens-
werterweise bereiterklärten, uns zu unterstützen. Hierdurch konnten
wir die Versuchsinhalte und unsere Methodik weiterentwickeln. Es
folgten weitere Studien im Auftrag der Berufsgenossenschaft Holz und
Metall (BGHM) sowie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV). Diese Entwicklung bot uns einen idealen Rahmen, um den
wissenschaftlichen Kenntnisstand fortzuschreiben.
Ich war von Beginn an mit der Planung und Ausführung der Stu-
dien beauftragt. Als graduierter Ingenieur musste ich mir das dazu
notwendige medizinische Fachwissen selbst aneignen. Eine intensive
Literaturrecherche und Konsultationen mit Ärzten halfen mir dabei
und weckten mein Interesse an der Verletzungs-Biomechanik. Der
Vorbereitung folgten viele Stunden im Labor, unzählige Versuche und
eine anspruchsvolle Datenauswertung. All das wäre nicht ohne die
Hilfe meiner Unterstützer möglich gewesen. Ich möchte mich daher
bei den Studienträgern für ihr Engagement bedanken, bei meinen Kol-
legen am Fraunhofer IFF und unseren Partnern an der Magdeburger
VIII Vorwort
Universitätsklinik, die mir bei der Organisation und Durchführung
der Probandenversuche halfen, bei Prof. Elkmann, der den Anstoß
zu allem gab, sich in höchstem Maße für gute Rahmenbedingungen
einsetzte und mir stets hilfreich zur Seite stand, und bei meinem
Betreuer Prof. Witte, der mich mit väterlicher Fürsorge und guten
Ratschlägen besonnen durch die Promotion geleitete. Einen besonde-
renDankrichteichanmeineFamilieundFreunde,diemichdurchihre
Zuversicht stets aufs Neue motivierten, und an meine Liebe Katja, die
immer an mich glaubte, mich unterstützte und mit liebevoller Geduld
auf unzählige gemeinsame Stunden verzichtete.
Magdeburg, im Mai 2019 Roland Behrens
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
1.1 Einführung in die Mensch-Roboter-Kollaboration . . . 2
1.1.1 Interaktionsformen . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Gefahren und Sicherheitsprinzipien . . . . . . . 4
1.2 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Kenntnisstand zu biomechanischen Grenzwerten 11
2.1 Begriffe und Definitionen . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Beanspruchungsgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2.1 Schwereskalen und -kodierungen . . . . . . . . 16
2.2.2 Studien zu Beanspruchungsformen . . . . . . . 19
2.2.3 Beanspruchungsgrenzen in der technischen Re-
gelsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Belastungswerte und -grenzen . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.1 Physikalische Größen einer Stoßbelastung . . . 24
2.3.2 Erarbeitungsmethoden . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3.3 Biomechanische Belastungswerte aus der wis-
senschaftlichen Forschung . . . . . . . . . . . . 36
2.3.4 Belastungsgrenzen aus der technischen Regel-
setzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4 Beanspruchungskriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.4.1 Grenzwertkriterium . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.4.2 Kinematische Kriterien . . . . . . . . . . . . . 49
2.4.3 Kinetische Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5 Verwendung von Belastungsgrenzen in der Robotik . . 53
2.5.1 Sicherheitsgerechte Konstruktion und Steuerung 54
2.5.2 Modellbasierte Sicherheitsprüfung . . . . . . . 54
2.5.3 Messtechnische Sicherheitsprüfung . . . . . . . 55
X Inhaltsverzeichnis
3 Präzisierung der Zielstellung 57
3.1 Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.1.1 Gesellschaftliche Anforderungen. . . . . . . . . 57
3.1.2 Wissenschaftliche Anforderungen . . . . . . . . 58
3.1.3 Zweckbezogene Anforderungen . . . . . . . . . 59
3.2 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4 Hergang und Wirkung von Stoßbelastungen 63
4.1 Aufbau und Eigenschaften von Körpergewebe . . . . . 64
4.1.1 Anatomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.1.2 Biomechanische Eigenschaften . . . . . . . . . 71
4.2 Leichte Beanspruchungen . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.2.1 Schmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.2.2 Leichte Verletzung . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.3 Mechanische Betrachtung des Stoßes . . . . . . . . . . 85
4.3.1 Ideal-elastischer Stoß . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3.2 Besonderheiten bei einem Mehrkörpersystem . 90
4.3.3 Visko-elastischer Stoß . . . . . . . . . . . . . . 94
5 Protokoll zur Durchführung einer Probandenstudie 105
5.1 Rahmenbedingungen und Inhalte . . . . . . . . . . . . 106
5.1.1 Einbeziehung medizinischer Expertise . . . . . 106
5.1.2 Festlegung der Beanspruchungsziele . . . . . . 107
5.1.3 Probanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.1.4 Festlegung der Körperstellen . . . . . . . . . . 110
5.1.5 Lastparameter und Basisgrößen . . . . . . . . . 112
5.2 Apparatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.2.1 Wahl der Erarbeitungsmethode . . . . . . . . . 115
5.2.2 Stoßpendel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2.3 Messmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2.4 Dokumentationsmittel . . . . . . . . . . . . . . 129
5.2.5 Weitere Hilfsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.3 Abläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.3.1 Kenngrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.3.2 Versuchsplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . 134