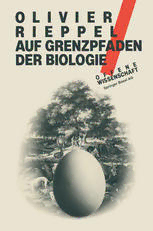Table Of Content0 F F E N E
WISSENSCHAFT
Birkhäuser
OLlVIER
RIEPPEL
AUF GRENZPFADEN
DER BIOLOGIE
Springer Basel AG
CIP-Kuntitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Rieppel, Olivier:
Auf Grenzpfaden der Biologie I Olivier
Rieppel.
(Offene Wissenschaft)
ISBN 978-3-0348-6740-5 ISBN 978-3-0348-6739-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-0348-6739-9
Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vor
behalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des
Verlages in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere
Verfahren reproduziert werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch
Vortrag, Funk und Fernsehen bleiben vorbehalten.
© 1984 Springer Basel AG
Ursprünglich erschienen bei Birkhäuser Verlag, Basel1984
Softcoverreprint ofthe hardcover Istedition 1984
Umschlaggestaltung: Peter Hajnoczky, Zürich
ISBN 978-3-0348-6740-5
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stufen der Welterfahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Materie und Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Das Problem der Urbilder in der modernen
Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Die Struktur wissenschaftlicher Theorien -
der Ursprung der Schlangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dinosaurier - Modell unserer Zukunft . . . . . . . . . . . . . 60
Über den Ursprung des Evolutionismus . . . . . . . . . . . . 71
Evolution und Fortschrittsglaube . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ein überlebender Dinosaurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Das Geheimnis der Fossilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Die Spaltung der modernen Evolutionstheorie . . . . . . . 110
Die Bedeutung des Akademiestreites von 1830
für die vergleichende Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Die Ordnung der Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5
Vorwort
Die Wanderung entlang der Grenze ist immer gefährlich, doch
das Risiko lohnt sich: Die Grenze umreißt das Gegebene,
Bewährte, erlaubt aber auch den Ausblick in die Fremde, ins
Neuland, ins Unbekannte. Dieses Buch ist eine solche Wande
rung auf einem Grenzpfad entlang der Grenze der Vernunft.
Mit dem Wort «Vernunft» möchte ich die Spielregeln des wis
senschaftlichen Denkens bezeichnen, jene Grenzen der Ratio,
der Kausalität und der Logik, die das wissenschaftliche Welt
bild umreißen. Insofern der Inhalt des vorliegenden Buches
diese Grenzen abzutasten, manchmal in Frage zu stellen ver
sucht, wird es sich der Kritik aussetzen, einer Kritik jedoch,
die, wenn sie zur Reflexion und zum Dialog führt, fruchtbar
sein kann. Oft mögen die vorgelegten Gedanken nicht sonder
lich fruchtbar erscheinen: Sie stellen in Frage, machen auf
Grenzen aufmerksam, ohne viel Neuland zu erschließen. Das
Buch will zur Diskussion anregen, nicht Wissen verkünden!
Die vorgelegten Texte bewegen sich auch insofern entlang
der Grenze der Vernunft, als sie am Rande der täglichen wis
senschaftlichen Arbeit entstanden. Es sind Ideen, Fragen und
Ausblicke, die im Rahmen der strengen Kritik der wissen
schaftlichen Methode ein Stück Freiheit mit sich bringen, die
Freiheit, Grenzen zu überschreiten. Dies endet meist im Stol
pern, was sich in der Form des Textes ausweist. Er ist in Essays
gefaßt, in Versuche, Fragen und Themen einzukreisen, aus
verschiedenen Gesichtspunkten anzugehen, in der Hoffnung,
es mögen nicht Kreise entstehen, sondern eine Spirale. -
Zürich, im August 1984 Olivier Rieppel
7
Stufen der Welterfahrung
Die moderne Welt ist aufgeklärt. Die Hexen sind verbrannt,
die Dämonen sind ausgetrieben und Gott ist aus dem Weltall
hinausgeworfen: die Raumfahrt hat dieses Faktum hinlänglich
bewiesen, den Mann im Mond gegen das Sternenbanner ausge
tauscht. Die Wirtschaft ist prognostizierbar, die Krankheit dia
gnostizierbar, der Mann ist entmythologisiert und ebenso die
Frau. An Stelle ihrer Mythen tritt eine aufgeklärt-vernünftige
Psychologie oder einfach das Klischee. Vernunft und Wissen
schaft scheinen das erreicht zu haben, was als Weg und Ziel
der Christenheit seit alters vorgezeichnet schien und sich viel
leicht doch nur als Mißverständnis entpuppt: die Natur hat der
Mensch sich zum Untertan gemacht, sie wird von ihm
beherrscht.
Ist das richtig, ist das wahr? Wahr ist doch bestenfalls das,
was erlebt wird und nicht, was nur gedacht wird! Die Wissen
schaft mag den Wald mit Hilfe lateinischer Namen zu entmy
thologisieren versuchen, seine Wirkung zu bannen versuchen
- doch wer denkt schon an wissenschaftliche Namen, wenn er
nachts bei fahlem Mondschein seinen Weg durch den Wald
sucht? Der Wald ist dann nicht länger eine gedachte Sache,
sondern vielmehr ein Erlebnis. Der Baumstamm mit dem
abgebrochenen Ast tritt uns als Dämon entgegen, die metal
lene Jagdverbotstafel als grünlich schimmerndes Gesicht. Um
den Schrecken vollkommen zu machen, muß nur eine Erd
kröte oder eine Maus sich ihren Weg durch das Laub bahnen,
ein Windstoß die Blätter des nebenstehenden Busches rascheln
lassen oder das Mondlicht sich in den Augen einer entlaufenen
Katze spiegeln. Die Vernunft schützt uns nicht länger vor unse
rer Phantasie, der wissenschaftliche Name wird zum unwe
sentlichen Bestandteil des angsterregenden Baumes. Die
Wesen des Waldes stehen nicht länger als Objekte einer wissen
schaftlich geschulten Vernunft gegenüber, vielmehr wirken sie
direkt auf den Menschen, auf sein Erleben.
9
Und doch wird niemand behaupten, daß der Baum einen
Dämon in sich habe, der Busch eine Stimme. Vielmehr sind es
die Sinne, deren Wahrnehmung nicht mehr nur vernünftig ist,
die solche Eindrücke vermitteln. Es ist die Phantasie, die den
Baum als Dämon, den Busch als beredt erscheinen läßt - es ist
des Menschen Dämon, des Menschen Stimme, die ihm plötz
lich aus der Natur wie von außen entgegen treten. Die Natur
wird nicht mehr nur erkannt, sie wird erlebt, und zwar nicht
nur als Untersuchungsobjekt, sondern als Teil des Menschen
selbst.
Man kann diese Art der Naturerfahrung auch eine mytholo
gische nennen. Die mythologische Welterfahrung sucht nicht
nach dem reinen Objekt, das für sie nur als leeres Wort Gültig
keit hätte, sie sucht nach dem Sinn der Dinge dieser Welt,
indem sie diese Dinge in Beziehung setzt zum erlebenden
Menschen. Die Welt, die Natur, sind dabei selbst Teile des
erlebenden Menschen, ihm dabei aber von außen fremd und
unheimlich entgegentretend. Doch gibt diese Tatsache nicht
Anlaß zu Herrschsucht, sondern vielmehr zu Angst und Ehr
furcht.
Die Eingeborenen jeden Erdteiles erleben die Natur als
beseelt und dämonisiert. Die Götter sind allgegenwärtig sowie
die Seelen der Toten, Tiere und Pflanzen gelten als heilig,
heischen Ehrfurcht und flößen Angst ein. Die Natur ist Part
ner, oft überlegener Partner, dem gegenüber der Mensch
bescheiden bleiben muß: eine Bescheidenheit sich selbst
gegenüber, eine Angst und Ehrfurcht vor dem Dämon in der
eigenen Brust.
Angst auszuhalten ist jedoch nicht immer die Sache des
Menschen. Vielmehr sucht er sie zu überwinden, beispiels
weise durch Hoffnung auf eine Zukunft, die Erlösung und Heil
bringen soll. Während Jahwe durchaus noch die Züge der Lau
nenhaftigkeit und unerbittlichen Grausamkeit der Natur in sich
trägt, tritt mit dem Messias die Hoffnung auf Erlösung in die
Welt. Im Mittelalter war die Natur nicht mehr nur dämonisiert,
aber auch noch nicht entmythologisiert. Sie war vor allem
vergöttlicht. In ihr spiegelte sich das Werk Gottes, die Schöp
fung, im Guten wie im Bösen. Die Erlösung des Menschen
ergab sich, gernäss christlicher Tradition, durch den Auf-
10
stieg des menschlichen Geistes zu göttlicher Nähe. Für diesen
Aufstieg benützte der Mensch die «Scala Naturae», die «Leiter
der Natur». Denn man hatte früh schon erkannt, daß die Natur
Anlaß geben kann zu einer Ordnung. Im Mittelalter wurde die
Natur nach zunehmender Kompliziertheit der Dinge geordnet.
Zuunterst an der «Leiter der Natur» standen das Gestein, die
Erze und Mineralien, darauf folgten die Pflanzen, dann die
niederen, schließlich die höheren Tiere. Auf die Säugetiere
folgte der Mensch, dann eine Reihe von Geistwesen, zuoberst
an der Leiter stand Gott. In dieser «Scala Naturae» spiegelt
sich ein Fortschritt von Niederem zu Höherem, ein Fortschritt,
mit dem sich Hoffnung verbindet, die Hoffnung nämlich, daß
der menschliche Geist sich der göttlichen Sphäre annähern
und so der göttlichen Gnade teilhaftig werden könne.
Denselben Fortschrittsglauben und dieselbe Hoffnung fin
den sich wieder in den modernen Evolutionstheorien, inner
halb derer der Begriff «Gott» durch den Begriff «Natur» ersetzt
wurde. Entwicklung und damit Fortschritt sind in der Natur
begründet und die Natur ist auch jene Instanz, der die Wei
terentwicklung des Menschen und seiner Lebensumstände
anheimgestellt wird. Die Natur wird Wege finden, sie wird
Evolution, das heißt Wandel und Anpassung, ermöglichen, so
etwa lautet die moderne Hoffnung. Daß damit auch Angst
verbunden sein könnte, Angst davor, daß die Natur Wandel
und Anpassung wider die Ziele des Menschen erzwingen
könnte, fällt nicht in Betracht, ebensowenig wie die Tatsache,
daß Evolution nur eine Stufe der Welterfahrung darstellt. Denn
der moderne Mensch gibt sich nicht mit der Hoffnung auf
göttliche Gnade zufrieden, er will diese Hoffnung begründet
sehen und er tut dies mit dem Mittel der Wissenschaftlichkeit.
Die wissenschaftliche Welterfahrung fordert eine Trennung
des Menschen von der Natur. Die Natur ist nicht mehr ein
Partner, mit dem sich der Mensch auseinandersetzt Vielmehr
steht die Natur dem Menschen gegenüber, seiner wissen
schaftlichen Erkenntnis zugänglich. Die wissenschaftliche
Erkenntnis eröffnet das Tor zum «wie» und «warum» der
Naturprozesse. Die Inhalte der Natur werden sorgfältig analy
siert und ihre Ursachen abgeklärt. Diese Haltung liefert dem
Menschen die Sicherheit gegenüber der Natur, welche die
11