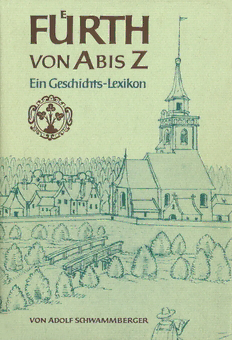Table Of ContentAdolf Schwammberger
Fürth von A bis Z
Ein Geschichtslexikon
Selbstverlag
der Stadt Fürth
Einbandentwurf: Alfred Linz, Nürnberg, nach einer Zeichnung von
Hans Bien 1629 und dem Fürther Gemeindesiegel von 1723. — Satz und
Druck: Ulrich-Druck, Fürth. — Buchbindereiarbeiten: Großbuchbinderei
G. Gebhardt, Ansbach.
Geleitwort
Seit der 2. Auflage der Chronik der Stadt Fürth von G. T. Chr. Fronmüller
im Jahre 1887 ist keine größere Veröffentlichung über die Geschichte
unserer Stadt erschienen. Die Stadtverwaltung freut sich daher, nunmehr
das Buch „Fürth von A bis Z, ein Geschichtslexikon“ vorlegen zu können.
Es will allen an der Fürther Geschichte Interessierten historisches Material
vermitteln, es will zu weiteren Studien anregen, gleichzeitig aber auch die
Freude an der Geschichte der Stadt, in der wir leben, mehren. Möge dem
Buch reicher Erfolg beschieden sein.
Kurt Scherzer
Oberbürgermeister
Geleitwort
Es gehört zu den Aufgaben des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek, ihre
Schätze zu erschließen und sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
Die beiden Institute wollen damit der Wissenschaft, aber auch dem
großen Interesse dienen, das die Fürther Bevölkerung allen geschichtlichen
Fragen entgegenbringt. Der Schul- und Kulturausschuß der Stadt Fürth
hat daher den Gedanken des Herrn Direktors Dr. Schwammberger, ein
Buch „Fürth von A bis Z“ als Geschichtslexikon für die Fürther Bevölkerung
herauszubringen, freudig begrüßt und der Stadtrat hat die Mittel dafür
genehmigt.
Das Schul- und Kulturreferat nimmt die Gelegenheit wahr, Herrn
Direktor Dr. Schwammberger für seine mühevolle Arbeit herzlich zu danken.
Karl Hauptmannl
Stadtschulrat
Vorwort
Dieses Buch heißt zwar „Fürth von A bis Z“; aber der Titel übertreibt:
man kann Fürth nicht von A bis Z kennen und erst recht nicht beschreiben.
Der Untertitel „Ein Geschichtslexikon“ schränkt bereits ein; er will
darauf hinweisen, daß man sich in diesem Buch ums Vergangene kümmert.
Das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek werden täglich (zu ihrer Freude) mit
Fragen bedacht, die sich mit der Fürther Geschichte beschäftigen. Daraus
entstand der Gedanke, die Antworten in einem „Lexikon“ zusammen
zufassen. Während der Bearbeitung stellte sich aber heraus, daß sich das
Buch nicht auf die Beantwortung der alltäglichen Fragen beschränken
könne. Der Fürther Geschichts- und besonders der kulturgeschichtliche Stoff
ist ja erst spärlich in Aufsätzen und Büchern erschlossen worden. Daher
macht es sich das Fürther Geschichtslexikon zur Aufgabe, auch bisher un
bekanntes Material vorzulegen und die Bearbeitung neuer Themen anzu
regen. Die Artikel sind daher, wo es angebracht schien, mit Quellen- und
Literaturangaben versehen.
Kein Lexikon kann alle Wunsche erfüllen: kein Gegenstand und beson
ders keine Person, die hier nicht genannt sind, wurden aus böser Absicht
übergangen. Das Werk heute lebender Politiker vermag erst die Nachwelt zu
würdigen; es blickt in die Zukunft. Daher werden Politiker nur genannt,
wenn ihr abgerundetes Leben vor uns liegt, oder wenn wir sie als Träger
einer städtischen Auszeichnung oder eines Bürgermeisteramtes zu registrie
ren haben.
Ich begann die Arbeit an diesem Buch vor sechs Jahren; große
Hindernisse stellten sich dem ersten Plan entgegen. Daher danke ich Herrn
Oberbürgermeister Kurt Scherzer und Herrn Stadtschulrat Karl Hauptmannl
herzlich dafür, daß sie mich in meiner Arbeit ermutigten, und dem Stadtrat
Fürth danke ich für das Verständnis, mit dem er die finanziellen Voraus
setzungen schuf, um das Lexikon herauszubringen.
Für freundliche Hinweise habe ich der Leiterin der Volkshochschule
Fürth, Frau Ruth Stäudtner, Herrn Dr. Hugo Nothmann, Herrn Gymnasial
professor Kurt Boegner, Herrn Dr. Willi Worthmüller in Fürth, Herrn
Staatsarchivdirektor Dr. Fritz Schnelbögl - Nürnberg, Herrn Oberregie
rungsarchivrat Dr. Günther Schuhmann - Nürnberg, Herrn Oberarchivrat
Dr. Gerhard Hirschmann - Nürnberg, Herrn Oberkonservator Dr. Günther
Schiedlausky - Germanisches Nationalmuseum - Nürnberg, und dem Leiter
des Stadtarchivs Erlangen, Herrn Stadtarchivar Johannes Bischof f, zu danken.
Ich durfte im Pfarramt St. Michael während vieler Stunden arbeiten; für
alles freundliche Entgegenkommen danke ich Herrn Kirchenrat Karl Will
und Fräulein Auguste Schmitt.
Ich danke meinen Mitarbeiterinnen im Stadtarchiv Frau Emmy
Wittenmayer und Frl. Brigitte Wölfel, die mich durch geduldige Kleinarbeit
unermüdlich unterstützt haben.
Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Dr. Hugo Nothmann, der
während ungezählter Stunden in selbstloser Arbeit das Korrekturenlesen
übernahm.
Dr. Adolf Schwammberger
Aachen: Eine Wallfahrt nach Aachen wurde am 11. 10. 1517 dem Jörg
Muggenhofer auferlegt, nachdem er den Hans Seidel zu Fürth erschlagen
hatte; s. T Flurdenkmale.
Lit.: Zettler, Franz, Die Flurdenkmale des Stadt- und Landkreises Fürth, in: Das
Steinkreuz, 16. ]&., 1960, Heft 1f2.
Abdecker, s. T Schinder.
Aberglaube. 1441 klagte vor dem T Egericht Fürth Heinz Loder (Lotter)
gegen den Heinz Geiger, weil ihn der bezichtigte, er habe (mit Hilfe
seiner Frau) etwas unterm T „drischeufel", der Türschwelle (des Stalles)
eingegraben, damit des Geigers Kuh eingehen solle. Auch sei er, nach den
Gerüchten, die Geiger aussprengt, den Zauberern nachgelaufen, um ihn,
den Geiger, um Leib und Leben zu bringen. (Bamberg Staatsarchiv, Dompr.
2145 BI. 122).
Im Jahre 1448 lebte in Kleinreuth (bei Schweinau) ein Hans Fischer,
und in Großreuth hausten der Ullein Fischer und seine Schwester Elsbeth.
Sie waren verwandt, vielleicht Geschwister. Einer der beiden Fischer hatte
einen Sohn, der die Tochter einer gewissen Anna Helseweck in Eberhards-
hof geheiratet hatte. Mit dieser Verbindung waren die alten Fischers nicht
einverstanden; sie brachten daher das Gerücht auf, die alte Helseweckin
habe zusammen mit der Kunigunde Kraus von Gostenhof den jungen
Fischer „mit. . . Zauberei zubracht (= dahin gebracht), daß er der Helse
weckin Tochter habe nehmen müssen"; das sei „doch wider den heiligen
christlichen Glauben und eine Ketzerei". Dieses Gerücht kam zu Ohren
der „Zauberinnen". Die beiden wandten sich an das Egericht in Fürth und
verklagten die Verleumder (1448). Der Ausgang des Prozesses ist uns nicht
bekannt. (Bamberg Staatsarchiv, Dompr. 2146 Bl. 42).
1609 lebte in Fürth der Leineweber Johannes Rudorf; er hatte die
Nürnbergerin Juliane Engelhardt kennengelernt und warb um sie. Juliane
fühlte sich von dem Leineweber angezogen und abgestoßen zugleich; sie
wußte nicht, wie sie sich gegen seine Werbung wehren sollte. Hans Rudorf
war nürnbergischer Untertan. Juliane verklagte ihn beim Rate der Reichs
stadt, „er habe ihr bei einer Zeche drei unterschiedliche Trünke zu
gebracht" und dadurch verursacht, „daß sie ohne ihn nicht sein könnte",
und „daß sie weder Tag noch Nacht vor ihm Ruhe habe" und daß er sie
um ihre Gesundheit gebracht habe. Johannes Rudorf kam ins Lochgefäng
nis. Er wurde geprüft, doch konnte man keine Schuld an ihm finden - am
29. Juli 1609 entließ ihn der Rat aus dem Gefängnis. Am 8. August 1609
9
heirateten Johann Rudorf und Juliane Engelhardt in der St. Lorenzkirche
zu Nürnberg. Am 9. August stellte der Nürnberger Rat dem jungen Ehe
mann ein Zeugnis darüber aus, daß an ihm nichts von Zauberei sei. (Fürth
Stadtarchiv Urk. 1609 Aug. 9).
Ein anderer Hinweis auf Fürther Hexenglauben: Am 17. Februar 1614
wurde im Fürther Friedhof ein Kind begraben, als dessen Vater „der
Drudenbanner" bezeichnet wird; Pfarrer Johann Hitzler, der den Eintrag
ins Sterberegister schrieb, bemerkte daneben: „Mein Herr und Gott!"
(Fürth Pfarramt St. Michael, Sterberegister).
Bei Friedrich Bock, Zur Volkskunde der Reichsstadt Nürnberg. Würz
burg 1959, S. 58 f. findet sich folgender Hinweis: Erstaunlich „ist die.Lei
stung eines Fürther Juden bei jenem großen Brand in Almoshof an Pfing
sten 1615 . . . Wolf Friedrich Stromer hatte zum Fest Freunde eingeladen
und führte ihnen auf seinem Hof ein Schießen mit seiner kleinen Kanone,
einem ,Falconetlein', vor. Einer der Bauern kam und bat, das Schießen
einzustellen, bei der Trockenheit könnte ein Brand auskommen. Stromer
. . . schoß weiter und stopfte, da es sich ja nur um Zielmunition handelte,
diesmal besonders viel alte Lumpen ins Rohr; und schon steckte der
Schuß ein Nachbardach in Brand, und daraus wurde dann ein ausgedehn
tes Großfeuer . . . Ganz Almoshof hätte draufgehen können, wenn nicht
(so schildert der Nürnberger Chronist Lüder) ein Fürther Jude von weitem
das Feuer gesehen hätte. Er eilte sofort herüber und half so: Auf einen
Laib Brot schrieb er einige hebräische Buchstaben, warf ihn ins Feuer,
drang selber durch die Flammen hindurch und schrieb auch an die Türen
und Läden der noch stehenden nächsten Häuser hebräische Buchstaben.
Dann verpfändete' er sich und sagte, wenn jetzt das Feuer doch noch
weiter um sich griffe, sollten sie ihn selber hi nein werf en. Es ist aber nicht
weitergegangen."
Als unglückbringend gilt: wenn man einen Spiegel zer
bricht (man hat 7 Jahre lang kein Glück mehr), wenn man mit dem linken
Fuß aus dem Bett steigt, wenn man einem Leichenwagen bzw. Sanitäts
auto begegnet (aber man kann das Unglück abwenden, wenn man einen
Knopf der Kleider festhält, bis man an drei Männern mit Brille vorbei
gekommen ist), wenn einem eine (schwarze) Katze über den Weg läuft
(man kann aber der Gefahr begegnen, indem man dreimal ausspuckt).
Juckt die rechte Hand, so hat man Pech.
Wenn man sich eine Nadel leihen läßt, so soll man sich nicht dafür
bedanken - sonst bekommt man Streit; auch für einen Ableger bedankt
man sich nicht - sonst gedeiht er nicht.
Die Zahl 13 gilt als Unglückszahl. In den Gasthöfen und Hotels
numeriert man die Zimmer in der Reihenfolge 11, 12, 14 . . . oder man
beginnt mit höheren Nummern, sodaß die 13 nicht vorkommt. In einem
Hotel ist das Zimmer 13 in 18 umgewandelt worden. Ein Garagen Vermie
ter fühlte sich gezwungen, die Nummernfolge so zu wählen: 11,12a, 12b,
14 - solange er noch die Garage 12b als Nr. 13 anbot, konnte er sie nicht
vermieten.
10