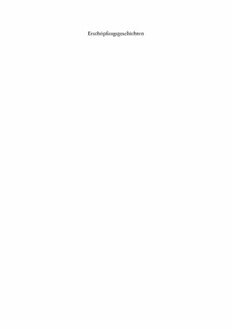Table Of ContentErschöpfungsgeschichten
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
vita activa
Herausgegeben von
Claudia Lillge und Thorsten Unger
Wissenschaftlicher Beirat
Franz Josef-Deiters
Bernd Stiegler
Isabella von Treskow
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
Jan Gerstner, Julian Osthues (Hg.)
Erschöpfungsgeschichten
Kehrseiten und Kontrapunkte der Moderne
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Zentralen Forschungsförderung der Universität Bremen
Umschlagabbildung: The Creation Michelangelo Italy Vatican, Michael Giorgio Castielli; bearbeitete
Coverabbildung von Jan C. Watzlawik
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des Verlags nicht zulässig.
© 2021 Wilhelm Fink Verlag, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore;
Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland)
www.fink.de
Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München
Herstellung: Brill Deutschland GmbH, Paderborn
ISSN 2629-7299
ISBN 978-3-7705-6447-7 (paperback)
ISBN 978-3-8467-6447-3 (e-book)
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
Inhalt
Julian Osthues, Jan Gerstner
Erschöpfungsgeschichten
Kehrseiten und Kontrapunkte der Moderne – Zur Einführung ......... 1
MODERNE ERSCHÖPFUNGSGESCHICHTE
Wolfgang Martynkewicz
Der Skandal der Erschöpfung ........................................ 23
Horst Gruner
Topographie der Erschöpfung
Die Narrative der Ratgeberliteratur zur Nervosität und
Neurasthenie um 1900 ............................................... 29
Eva Stubenrauch
Kontrapunkt moderner Historizität
Erschöpfung als Gegenwartsdiagnose bei Görres, Nietzsche
und Gumbrecht ..................................................... 47
ERSCHÖPFUNG, KAPITAL UND ARBEIT
Jan C. Watzlawik
Dinge, die ausbrennen
Über Materialermüdung und Sachschaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Jörn Etzold
Steigerung und Erschöpfung
Zu Walter Benjamins Kapitalismus als Religion ........................ 85
Jennifer Pavlik
Der Weltverlust des animal laborans, seine Suche nach dem
konsumierbaren Glück und die Widerständigkeit des Ästhetischen ...... 101
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
vi Inhalt
SCHREIBWEISEN DER ERSCHÖPFUNG
Dieter Heimböckel
Lieber nicht
Genosse Bartleby – Genosse Idiot ..................................... 119
Iulia-Karin Patrut
„Seine große Erschöpfung machte es begreiflich.“
Spielarten und Funktionen von Erschöpfung in Franz Kafkas
Das Schloß .......................................................... 139
Georges Felten
Grauzone Erschöpfung
Utopische Kippfiguren und deren Arretierung in Anna Seghers’
Der Ausflug der toten Mädchen ....................................... 159
Axel Dunker
„Jetzt merk ich erst, wie müd ich bin!“
Der erschöpfte Erzähler in Peter Kurzecks Das alte Jahrhundert
und Das schwarze Buch .............................................. 179
Jakob Christoph Heller
Erosive Poetik als Antwort auf die Erschöpfungen der Spätmoderne
Max Frischs Der Mensch erscheint im Holozän ......................... 191
ERSCHÖPFUNGSPATHOLOGIE UND DIE WIEDERKEHR
DER MELANCHOLIE
Till Huber, Immanuel Nover
Von der Erschöpfung zur Depression
Überlegungen zu einer Ästhetik des Depressiven anhand
von Lars von Triers Melancholia .................................. 209
Hauke Kuhlmann
Traurige Hunde
Beobachtungen zum Melancholiediskurs der Gegenwart in
Marion Poschmanns Hundenovelle ................................... 229
Register ............................................................. 247
Autorinnen und Autoren ............................................ 251
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
Julian Osthues, Jan Gerstner
Erschöpfungsgeschichten
Kehrseiten und Kontrapunkte der Moderne – Zur Einführung
„Our age, it seems, is the age of exhaustion.“1 Es scheint, folgt man dem Tenor
einer Vielzahl aktueller Studien, derzeit nicht gut um den Menschen bestellt.
Zeitdiagnosen wie diese stehen gegenwärtig hoch im Kurs. Das zitierte State-
ment, mit dem die HerausgeberInnen in den 2017 veröffentlichten Sammel-
band Burnout, Fatigue, Exhaustion einleiten, steht beispielhaft für die Karriere
eines Begriffs, der in Diskursen der Gegenwart seit einigen Jahren geradezu
omnipräsent ist: Erschöpfung. Wie kaum ein anderes Konzept vermag Er-
schöpfung ein Lebens- und Zeitgefühl ins Bild zu setzen, das emblematisch
zur Selbstbeschreibung des Menschen in Moderne und Gegenwart avanciert
ist.2 Es mag wenig überraschen, dass der Begriff eine besondere Anziehungs-
kraft für kulturkritische Diskurse ausstrahlt, die ihm indes den Rang einer
Kultur- und Zeitdiagnose verliehen haben. Überforderung, Müdigkeit, Stress,
Burnout, Depression: Eine Vielzahl von Studien der vergangenen Jahre
tragen der Aktualität des Themas bereits im Titel Rechnung: Das erschöpfte
Selbst,3 Müdigkeitsgesellschaft,4 Erschöpfende Arbeit,5 Wir Ausgebrannten,6 Der
überforderte Mensch,7 Leistung und Erschöpfung,8 Soziale Erschöpfung,9 Die
1 Sighard Neckel / Anna Katharina Schaffner / Greta Wagner: Introduction. In: Burnout,
Fatigue, Exhaustion. An Interdisciplinary Perspective on a Modern Affection. Hg. v. dens.
Cham 2017, S. 1-26, hier S. 1.
2 Vgl. so auch das Fazit von Schaffner: „The rhetoric of our age is unique in that anxieties about
exhaustion, sustainability, and resilience no longer concern only the mind, body, or society
but our very habitat.“ (Anna Katharina Schaffner: Exhaustion. A History. New York 2016,
S. 242).
3 Alain Ehrenberg: Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart.
2. Aufl. Frankfurt a.M. 2015.
4 B yung-Chul Han: Müdigkeitsgesellschaft. Berlin 2010.
5 Heiner Keupp / Helga Dill (Hg.): Erschöpfende Arbeit. Gesundheit und Prävention in der
flexiblen Arbeitswelt. Bielefeld 2010.
6 Hilmar Klute: Wir Ausgebrannten. Vom neuen Trend, erschöpft zu sein. München 2012.
7 Patrick Kury: Der überforderte Mensch. Eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout.
Frankfurt a.M. 2012.
8 Sighard Neckel / Greta Wagner (Hg.): Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wett-
bewerbsgesellschaft. Frankfurt a.M. 2013.
9 Ronald Lutz: Soziale Erschöpfung. Kulturelle Kontexte sozialer Ungleichheit. Weinheim,
Basel 2014.
© Wilhelm Fink Verlag, 2021 | doi:10.30965/9783846764473_002
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
2 Julian Osthues, Jan Gerstner
erschöpfte Gesellschaft,10 Exhaustion. A History,11 sowie unlängst 2018 Das über-
forderte Subjekt12 – die Liste ließe sich weiter fortführen. Im Schnittfeld von
Soziologie, Sozialphilosophie, Psychologie und Kulturwissenschaften formiert
sich ein Erschöpfungsdiskurs der Gegenwart, der die soziokulturelle Tragweite
und Brisanz des Phänomens verdeutlicht. Dabei sei „[d]ie Rede von der Er-
schöpfung“, wie Wolfgang Martynkewicz in Das Zeitalter der Erschöpfung
bilanziert hat, nicht nur „ubiquitär“ geworden. Hinzu komme, dass sie „immer
neue Varianten“ generiere:
Wer ist nicht alles erschöpft – und was ist nicht alles von Erschöpfung bedroht:
die menschliche Leistungsfähigkeit, das Ich in der digitalen Datenflut, die
Ressourcen und Energien, der Fußballtrainer Rangnick, das männliche Selbst-
bild, die christlichen Religionen, die Zeugungskraft und die Sexualität im All-
gemeinen, die Lehrer, die Professoren und Manager, die Zweierbeziehung und die
Geschlechterdifferenz, der Kreidefelsen auf Rügen und – natürlich – die Politik,
das neoliberale Wirtschaftsmodell und – last but not least – die europäische
Idee.13
Dass die Virulenz des Themas alles andere als zu ermüden scheint, sondern
weiter anhält, zeigt ein Blick auf zwei Diskursbereiche. Zum einen hat die
fortschreitende Digitalisierung der Gegenwart in den vergangenen Jahren
mehr und mehr Kritik auf sich gezogen. Das hat einige Studien dazu ver-
anlasst, in der übermäßigen Mediennutzung eine potentielle Ursache für
Krankheiten zu sehen, die mit körperlichen wie psychischen Erschöpfungs-
erscheinungen verknüpft sind. Wenn in neueren Publikationen titelgebend
Schlagwörter wie Digitale Erschöpfung,14 Digitale Depression15 oder Digitaler
Burnout16 auftauchen, mag das angesichts der steigenden Bedeutung digitaler
10 Stephan Grünewald: Die erschöpfte Gesellschaft. Warum Deutschland neu träumen
muss. Freiburg, Basel, Wien 2015.
11 S chaffner: Exhaustion.
12 Thomas Fuchs / Lukas Iwer / Stefano Micali (Hg.): Das überforderte Subjekt. Zeit-
diagnosen einer beschleunigten Gesellschaft. Frankfurt a.M. 2018.
13 Wolfgang Martynkewicz: Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des
Menschen durch die Moderne. Berlin 2013, S. 9; vgl. auch Schaffner in ihrer Kultur-
geschichte Exhaustion, S. 3, 11; zur Feststellung einer „ubiquitous exhaustion“ vgl. dies.:
Exhaustion and the Pathologization of Modernity. In: Journal of Medical Humanities 37
(2016), S. 327-341, hier S. 337f.
14 Markus Albers: Digitale Erschöpfung. Wie wir die Kontrolle über unser Leben wieder-
gewinnen. München 2017.
15 Sarah Diefenbach / Daniel Ullrich: Digitale Depression. Wie neue Medien unser Glücks-
empfinden verändern. München 2016.
16 Alexander Markowetz: Digitaler Burnout. Warum unsere permanente Smartphone-
Nutzung gefährlich ist. München 2015.
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
Erschöpfungsgeschichten 3
Medien in der Lebens- und Arbeitswelt einerseits nicht überraschen; es zeigt
andererseits auch, wie geläufig die Rede von der Erschöpfung mittlerweile
zur Problematisierung von Gegenwartsphänomenen geworden ist. Eine be-
sondere Aktualität erfährt Erschöpfung in einem Diskursfeld, wo der Begriff
in jüngster Zeit noch weiter an Schlagkraft gewonnen hat: Erschöpft ist nicht
nur der Mensch. Im Zentrum von Debatten um die ‚Klimakrise‘ steht etwa die
Ausbeutung der Natur durch den Menschen. Ein konkretes Beispiel ist der so-
genannte Earth overshoot Day (dt. ‚Welterschöpfungs-‘ oder ‚Überlastungstag‘),
der jedes Jahr um einige Tage weiter nach vorne rückt. Gemeint ist der Tag, an
dem die natürlichen Ressourcen des Planeten, die dem Menschen jährlich zur
Verfügung stehen, bereits verbraucht bzw. ausgeschöpft sind.17 Erschöpfung
und mit ihr assoziierte Vorstellungen, wie z.B. das Ende der Ressourcen, das
Artensterben oder die Degradation der Böden, avancieren hier zu politischen
Kampfbegriffen, die das Verhältnis des Menschen zur Natur problematisieren.
Mit der Vorstellung von der totalen Erschöpfung unseres Planeten und der
Irreversibilität der natürlichen Ordnung rückt gleichsam die Frage nach den
historischen Grenzen des ‚Anthropozäns‘, also das Ende des Menschenzeit-
alters, in den Blick.
Wie die Beispiele zeigen, ist der Rede von Erschöpfung nicht nur immer
schon eine negative Wertung unterlegt. Sie fungiert dabei insbesondere als
soziokulturelle Zuschreibung und mehr noch: sie ist Ausdruck einer Kultur-
und Zeitkritik. Mit Erschöpfung ist folglich ein Diskursraum umschrieben, „a
discursive space in which specific cultural discontents are articulated.“18 Wenn
nachfolgend von einem ‚Erschöpfungsdiskurs der Gegenwart‘ gesprochen
wird, so ist zu berücksichtigen, dass dieser als interdiskursives Geflecht zu ver-
stehen ist, das sich im Spannungsfeld von u.a. medizinischen, ökonomisch-
technologischen, soziologischen und kulturwissenschaftlichen Diskursen
formiert. Eine besondere Resonanz hat der Begriff, wie die erwähnten Bei-
spiele andeuten, in den vergangenen Jahren vor allem in der Soziologie, der
Sozialphilosophie und der Psychologie erfahren, die einen zeitdiagnostischen
Zusammenhang zwischen Gesellschaft und mit Erschöpfung assoziierten
Pathologien erkennen.
Hochkonjunktur hat Erschöpfung besonders dort, wo der Zustand spät-
moderner Leistungssubjekte zur Disposition steht, die auf eine sich stetig be-
schleunigende Lebens- und Arbeitswelt mit Überforderung, Überdruss und
17 War dieser Tag 2015 noch am 13.8., so rückte er bereits ein Jahr später auf den 3.8., 2017 auf
den 2.8. und 2018 auf den 1.8. (vgl. dazu https://www.overshootday.org; zuletzt geprüft am
21.5.2019).
18 Neckel / Schaffner / Wagner: Introduction, S. 2.
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):
4 Julian Osthues, Jan Gerstner
Entfremdung19 bis hin zu physio-psychischen Ausfallerscheinungen reagieren:
Burnout, Depression, Fatigue. Der erschöpfte Mensch erscheint dabei nicht
selten als Kehr- und Schattenseite der Produktivität, als Wiedergänger und
„leidender Antiheld einer Erfolgskultur, deren alleiniges Maß der eigene Vor-
rang im Wettbewerb ist.“20 Wenn der Begriff fällt, herrscht im öffentlichen
Diskurs zuweilen ein negatives, kulturkritisches Klima, eine Krisenrhetorik,
die den Ausnahmezustand zugleich pathologisiert und normalisiert. Dies
hat der Erschöpfung den Rang einer kollektiven Pathologie verliehen: sie
ist ebenso Normalzustand wie Massenphänomen. In der Zeitdiagnose ver-
schwimmen folglich die Grenzen zwischen Pathologie und Normalität. „Das
Volk der Erschöpften“ titelte entsprechend 2011 eine Ausgabe des Spiegel zum
Thema Ausgebrannt. Das überforderte Ich.21 Von der Erschöpfung als „Volks-
krankheit des 21. Jahrhunderts“ heißt es dort, sie habe mittlerweile das Aus-
maß einer „modernen Epidemie“ erreicht. Das scheinbar widersprüchliche
Verhältnis von Normalität und Abweichung in der Stilisierung des Ausnahme-
zustands einer Krankheit zur kollektiven Erfahrung wurde auch in einigen
einschlägigen Studien der vergangenen Jahre thematisiert: Von Depression als
einer „Pathologie der Spätmoderne“, die sich zukünftig zur „strukturell unaus-
weichlichen Allgemeinerfahrung verdichten“ könnte,22 spricht etwa Hartmut
Rosa in seiner Studie zur Beschleunigung, während der Philosoph Byung-
Chul Han sie in Müdigkeitsgesellschaft als „Kennzeichen der spätmodernen
Leistungsgesellschaft“23 bezeichnet und zusammen mit Burnout als typische
„psychische Erkrankung[ ] von heute“24 einstuft. Alain Ehrenberg geht davon
aus, dass es sich bei der Depression um eine „Demokratisierung des
19 Zum Verhältnis von Entfremdung und Erschöpfungspathologien (Depression, Burn-
out) in aktuellen Arbeiten zu Entfremdungstheorien vgl. Christoph Henning: Theorien
der Entfremdung zur Einführung. Hamburg 2015, S. 176-182; Peter V. Zima: Entfremdung.
Pathologien der postmodernen Gesellschaft. Tübingen 2014, S. 140-147.
20 Sighard Neckel / Greta Wagner: Einleitung. Leistung und Erschöpfung. In: Leistung und
Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. Hg. v. dens. 2. Aufl. Frankfurt
a.M. 2014, S. 7-25, hier S. 8.
21 Markus Dettmer / Samiha Shafy / Janko Tietz: Volk der Erschöpften. In: Der Spiegel,
24.1.2011, H. 4 (2011), S. 114-122.
22 Hartmut Rosa: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne.
10. Aufl. Frankfurt a.M. 2014, S. 388. An anderer Stelle spricht Rosa davon, „die Depression
[könne] ohne Zweifel als die verbreitetste und charakteristischste Pathologie der Zeit be-
griffen werden.“ (Ders.: Beschleunigung und Depression – Überlegungen zum Zeitver-
hältnis der Moderne. In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 65,
H. 9/10 (2011), S. 1041-1060, hier S. 1055, Herv. i. Orig.).
23 Byung-Chul Han: Müdigkeitsgesellschaft. Um die Essays Burnoutgesellschaft und Hoch-
Zeit erweiterte Neuausgabe. Berlin 2016, S. 50.
24 Ebd., S. 72.
0(cid:40)(cid:32)(cid:31)6(cid:34)(cid:1)3(cid:38)(cid:39)(cid:30)(cid:40)9(cid:38)(cid:1)(cid:40)(cid:34)8(cid:1)06(cid:34)(cid:1).9B(cid:38)(cid:39)(cid:34)9B(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:14)(cid:12)(cid:13)(cid:2)(cid:8)(cid:2)(cid:13)(cid:9)(cid:11)(cid:12)(cid:2)(cid:11)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:2)(cid:8)
/9B(cid:40)(cid:34)(cid:39)9B:9(cid:32)689(cid:34)(cid:1)(cid:41)(cid:35)(cid:34)(cid:1)-B(cid:31)(cid:32)(cid:32) 7(cid:35)(cid:33)(cid:5)(cid:13)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:7)(cid:15)(cid:9)(cid:5)(cid:15)(cid:10)(cid:5)42
(cid:41)(cid:31)6(cid:1)5(cid:34)(cid:31)(cid:41)9B(cid:38)(cid:31)(cid:39)6(cid:39)(cid:1)19(cid:31)(cid:36)G(cid:31):