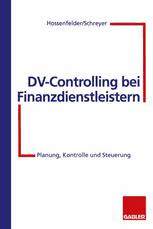Table Of ContentHossenfelder/Schreyer . DV-Controlling bei Finanzdienstleistem
Herausgegeben von
Christoph Meyer und Uwe E. Schroder
Wolfgang Hossenfelder / Frank Schreyer
DV-Controlling bei
Finanzdienstleistern
Planung, Kontrolle
und Steuerung
GABLER
Die Deutsche Bibliothek - ClP-Einheitsaufnahme
Hossenfelder, Wolfgang:
DV-Controlling bei Finanzdienstleistem / Wolfgang
HossenfelderlFrank Schreyer. - Wiesbaden : Gabler, 1996
ISBN-13: 978-3-322-82571-1 e-ISBN-13: 978-3-322-82570-4
DOl: 10.1007/978-3-322-825704
NE: Schreyer, Frank:
Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen der Bertelsmann Fachinformation.
© Betriebswirtsehaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1996
Lektorat: Silke StrauB und Iris Mallmann
Softeover reprint of the hardcover 1st edition 1996
Das Werk einsehlicBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlieh gcsehtitzt.
Jedc Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrcchtsgesctzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulassig und strafuar. Das gilt insbe
sondere flir Vervielfaltigungcn, Ubcrsetzungen, Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und Verarbcitung in elektronischen Systemen.
Hoehste inhaltliche und technischc Qualitat unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produktion
und Auslieferung unserer Btieher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses Buch ist auf saurefreiem
und chlorfrei geblciehtem Papier gedruckt. Die EinsehweiBfolie Polyathylen besteht aus organi
schen Grundstoffcn, die weder bei der Herstellung noch bei der Verbrennung Sehadstoffe freiset
zen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB solche Namen
im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und
daher von jedermann benutzt werden dlirften.
Satz: Publishing Service Helga Schulz, Dreieich-Dreieichenhain
ISBN-13: 978-3-322-82571-1
Vorwort der Herausgeber
Angesichts der immensen DV-Investitionen und der hohen laufenden Kosten der
Informationsverarbeitung im Zuge der zunehmend DV-gestiitzten Leistungserstellung bei
Finanzdienstleistem kommt dem DV-Controlling heute eine auBerordentlich groBe
Bedeutung zu. Die Notwendigkeit entscheidungsorientierter Informationen ist unstrittig,
fraglich ist jedoch die richtige Handhabung der Instrumente des DV-Controlling und die
konkrete organisatorische Ausgestaltung des DV-Controlling selbst.
Bisher existiert keine geschlossene Darstellung dieses wichtigen Themas. Die Schwer
punkte der bisherigen Veraffentlichungen liegen auf dem operativen Controlling und dem
Controlling einzelner Teilbereiche, wie z. B. Rechenzentrcn und Projekte. Das strategi
sche Controlling sowie dessen Verbindung zum operativen Controlling wurden bisher
nicht behandelt. Investitionsrechnungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen wurden nur ru
dim en tar untersucht.
In dem vorliegenden Werk werden theoretische Konzepte des strategischen und operati
yen Controlling verstandlich und nachvollziehbar in die Praxis umgesetzt. Es wird ein
durchgangiges Instrumentarium aufgezeigt, das die Planung, Kontrolle und Steuerung
der Effektivitat und Effizienz im Organisations- und Informatik-Bereich von Finanz
dienstleistem wesentlich steigert. Erstmalig zeigen die Autoren die Verbindung der
Untemehmensziele mit den Zielen des Organisations- und Informatik-Bereichs auf. Es
wird herausgestellt, mit welchen Instrumenten die Ziele der Eigentiimer (Shareholder
Value) in der Informatik transparent gemacht werden kannen.
Dr. Wolfgang Hossenfelder und Frank Schreyer skizzieren zunachst Ziele und Aufgaben
des DV-Controlling. Die Entscheidungstrager sollen bei der Planung, Kontrolle und
Steuerung von Ressourcenbeschaffung und -einsatz bestmaglich unterstiitzt werden, urn
die Unterstiitzung der Untemehmensziele durch das DV-Controlling zu gewahrleisten.
Die dafiir benatigten strategischen und operativen Instrumente des DV-Controlling und
ihre Einfiihrung werden anhand von Leitfiiden, Checklisten und Fragebagen konkreti
siert. Wichtige Grundsatze flir die Informationsversorgung und die Informations
bedarfsanalyse werden aufgestellt und anschaulich erlautert.
Einen weiteren Schwerpunkt des Werkes bilden Investitionsentscheidungen in der
Informatik. Die Autoren entwickeln ein auf die speziellen Voraussetzungen der
Informatik-Investitionen abgestimmtes Verfahren der lnvestitionsrechnung.
Die "klassischen" Kosten-lLeistungsrechnungssysteme stoBen aufgrund des hohen
Gemeinkostenanteils und der speziellen Zurechnungsprobleme im Informatik-Bereich an
ihre Grenzen. Die Autoren entwickeln daher eine prozeBorientierte Verrechnung im
Rahmen eines integrationsorientierten Rechnungswesens. Dabei wird der innerbetriebli
chen Leistungsverrechnung und der Behandlung von Projekten besonderes Gewicht bei
gemessen. Dem gezeigten Kennzahlensystem flir das DV-Controlling kannen wertvolle
Anregungen entnommen werden.
v
Den AbschluB bilden VorschHige zur Organisation des DV-Controlling, wobei speziell auf
Fragen der Projektorganisation und Gremienbildung eingegangen wird. Auch die organi
satorischen Aspekte der EinfUhrung des skizzierten DV-Controlling werden behandelt.
Das vorliegende Werk stellt eine gelungene Synthese aus theoretischer Fundierung und Um
setzungserfahrung in der praktischen Arbeit des DV-Controlling dar.
Dr. Hossenfelder und Herrn Schreyer danken wir fUr die sehr konkrete und anschauliche
Darstellung dieses aktuellen und wichtigen Problemfeldes.
Dipl.-Kfm. Christoph Meyer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar fUr Bankwirtschaft der Universitat
Munchen
Dipl.-Kfm. Uwe E. Schroder
GeschiiftsfUhrendes Vorstandsmitglied der vbb Vereinigung fUr Bankberufsbildung
e. v., Frankfurt am Main
VI
Inhaltsverzeichnis
1. Bedeutung der Informationsverarbeitung fUr Finanzdienstleister ........ .
2. Ziele der Finanzdienstleister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Anwendung des Shareholder Value-Konzeptes ...................... 5
2.2 Ableitung der Ziele fijr den Informatikbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Der Zielbeitrag des Informatikbereichs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1 Beschaffung.................................................. 9
3.2 Produktion................................................... 10
3.2.1 Produktionsfaktoren-System im Informatikbereich . . . . . . . . . . . .. 10
3.2.2 Das Cafeteria-Prinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2.3 Outsourcing............................................ 13
3.2.3.1 Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2.3.2 Determinanten.................................. 13
3.3 Absatz...................................................... 16
3.3.1 Ziel und Abgrenzungen der Preispolitik des Informatikbereichs . .. 16
3.3.2 Preispolitische Instrumente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17
3.3.3 Preispolitik gegeniiber einzelnen Kundengruppen . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3.3.1 Bereiche/Abteilungen der Zentrale und Inlands-
filialen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
3.3.3.2 Auslandsfilialen, in-und ausliindische Tochter-
gesellschaften und Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
3.3.3.3 Natiirliche und juristische Personen auBerhalb
des Konzems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24
4. Entscheidungen in der Informatik und Aufgaben des DV-Controlling. . . . .. 27
4.1 Strategische Entscheidungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27
4.2 Operative Entscheidungen ...................................... 29
4.3 Aufgabenbereiche des DV-Controlling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
5. Zusammenfassung der Kapitell-4 .................................. 33
6. Kosten-und Leistungsrechnung als Controlling-Instrument fUr den
Bereich der Informatik ............................................ 35
6.1 Ergebnisorientierte Untemehmensfiihrung -Schwachstellen im
Informatikbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35
6.2 Auswahl eines ergebnisorientierten Controlling-Instruments. . . . . . . . . . .. 36
6.2.1 Beriicksichtigung der Ergebnisorientierung (Zweck) . . . . . . . . . . .. 36
6.2.2 Beriicksichtigung der Entscheidungsorientierung .............. 37
6.2.3 Beriicksichtigung der Entwicklungstendenzen im
Informatikbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41
VII
6.2.4 Auswirkungen auf die operativen Controlling-Instrumente im
Informatikbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45
6.2.4.1 Wirkungen der Automatisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47
6.2.4.2 Wirkungen der Integration ........................ 54
6.2.4.3 Wirkungen der Flexibilisierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57
6.2.4.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58
6.3 Auswahl eines Kosten-und Leistungsrechnungs-Systems . . . . . . . . . . . . .. 59
6.4 Kosten-und Leistungsrechnung als ergebnisorientiertes
Controlling-Instrument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63
6.4.1 Vorgehensweise........................................ 63
6.4.2 Beispielhafte Darstellung des Informatikbereichs . . . . . . . . . . . . .. 63
6.4.3 Grundlagen und Voraussetzungen fUr eine Kosten-und
Leistungsrechnung .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
6.4.3.1 Allgemeine Voraussetzungen ...................... 67
6.4.3.2 Personelle und psychologische Voraussetzungen . . . . . .. 70
6.4.3.3 Spezielle Voraussetzungen im Informatikbereich . . . . . .. 71
6.4.4 Kostenartenrechnung.................................... 77
6.4.4.1 Grundkostenarten... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78
6.4.4.2 Kalkulatorische Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78
6.4.4.3 Gliederung von Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
6.4.4.4 Bildungskriterien fUr die Gliederungen von
Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80
6.4.5 Kostenstellenrechnung................................... 84
6.4.5.1 Aufgaben der Kostenstellenrechnung . . . . . . . . . . . . . . .. 84
6.4.5.2 Bildungskriterien fUr Kostenstellen ................. 85
6.4.5.3 Behandlung von Projekten ........................ 88
6.4.5.4 Kostenstellenhierarchie........................... 90
6.4.5.5 Planung der Kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92
6.4.6 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung ..................... 108
6.4.6.1 Notwendigkeit der Leistungsverrechnung ............ 108
6.4.6.2 Grundprinzip und Vorgehensweise bei der Ermittlung . .. 109
6.4.6.3 Verrechnung auf der Basis proportionaler Kosten. . . . . .. III
6.4.6.4 Integration von Fixkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112
6.4.7 Abweichungsanalysen zur Ermittlung von Steuerungs-
informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114
6.4.7.1 Das Produktionsergebnis als MaBstab zur Beurteilung
der Produktivitat und Effizienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. liS
6.4.7.2 Definition der Abweichungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lIS
6.5 Zusammenfassung............................................. 117
7. Investitionsentscheidungen in der Informatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119
7.1 Problemstellung............................................... 119
7.2 Ziele ........................................................ 119
7.3 Definitionen ................................................. 120
7.4 Grundsatze fiir Investitionsrechnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121
VIII
7.4.1 Grundsatz 1: Zieldefinition der Investition. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121
7.4.2 Grundsatz 2: Beriicksichtigung der Auswirkungen von
Investitionen ................................ 123
7.4.2.1 Auswirkungen auf die vorhandene Aufbau-und
Ablauforganisation .............................. 125
7.4.2.2 Auswirkungen aufvorhandene Systeme .............. 126
7.4.2.3 Auswirkungen auf das Personal .................... 127
7.4.3 Grundsatz 3: Betrachtung aller Organisationseinheiten . . . . . . . . .. 128
7.4.4 Grundsatz 4: Identifikation eines Auftraggebers ............... 129
7.4.5 Grundsatz 5: Betrachtung tiber den gesamten Lebenszyklus . . . . .. 130
7.4.6 Grundsatz 6: Abbildung in den Steuerungsinstrumenten . . . . . . . .. 132
7.5 Ubersicht tiber die Investitionsrechenverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133
7.5.1 Statische Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135
7.5.2 Dynamische Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
7.6 Die Beriicksichtigung der Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen . .. 140
7.6.1 Das Korrekturverfahren .................................. 141
7.6.2 Die Sensitivitatsanalyse .................................. 141
7.6.3 Die Risikoanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142
7.7 Der Kapitalwert bei Investitionsentscheidungen in der Inforrnatik ....... 146
7.7.1 Die Auswahl einer Investition ............................. 147
7.7.2 Die Wahl zwischen mehreren Investitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147
7.7.2.1 Berticksichtigung der Investitionsreihenfolge .......... 149
7.7.2.2 Beriicksichtigung des Integrationsgrades ............. 150
7.7.2.3 Das Entscheidungsbaumverfahren .................. 152
7.8 Die Anwendung der Kapitalwertmethode bei Inforrnatik-Investitionen. . .. 155
7.8.1 Errnittlung der Nutzeneffekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157
7.8.2 Errnittlung der Kosten .................................... 158
7.8.3 Errnittlung der Nutzungsdauer von Anwendungssystemen ....... 160
7.8.4 Errnittlung des KalkulationszinsfuBes ....................... 162
7.8.5 Veranderungen der Deterrninanten des Kapitalwertes . . . . . . . . . .. 166
7.9 Zusammenfassung ............................................. 168
8. Informationsversorgung in der Informatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171
8.1 Historische Entwicklung der Inforrnationsversorgung . . . . . . . . . . . . . . . .. 171
8.2 Entwicklungstendenzen der Inforrnationsversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172
8.3 Daten-oder Inforrnationsversorgung? ............................. 173
8.4 Ziele bei der Gestaltung der Inforrnationsversorgung ................. 175
8.5 Die Entscheidungstrager als Inforrnationsempflinger .................. 175
8.5.1 Entscheidungstrager im Inforrnatikbereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 176
8.5.2 Entscheidungstrager in anderen Untemehmensbereichen ........ 177
8.6 Die Entscheidungstrager als Inforrnationsnachfrager . . . . . . . . . . . . . . . . .. 177
8.7 Die Entscheidungsorientierung der Inforrnationen .................... 178
8.7.1 Zusammenhang zwischen Daten und Entscheidungssituation . . . .. 178
8.7.2 Verstandlichkeit!fransparenz.............................. 178
8.7.3 Aktualitat............................................. 178
IX
8.7.4 Orientierung am Verantwortungsbereich ..................... 179
8.7.5 Vollstandigkeit und Korrektheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 179
8.8 Grundsatze fUr die Informationsversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 179
8.8.1 Grundsatz 1: Zieldefinition der Informationsversorgung . . . . . . . .. 180
8.8.2 Grundsatz 2: Identifikation der Nutzer ....................... 182
8.8.3 Grundsatz 3: Informationsbedarfsanalyse als Ausgangspunkt . . . .. 183
8.8.4 Grundsatz 4: Vereinheitlichung von Informationen ............. 184
8.8.5 Grundsatz 5: Uberwindung der Abwehrhaltung beim
Empfanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186
8.8.6 Grundsatz 6: Interpretation einer Information ... . . . . . . . . . . . . .. 190
8.9 Die Gestaltung des Informationsversorgungssystems im Informatik-
bereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
8.9.1 Stufe I: Die Informationsbedarfsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
8.9.1.1 Verfahren ...................................... 192
8.9.1.2 Durchflihrung.................................. 193
8.9.1.3 Kritische Erfolgsfaktoren ......................... 197
8.9.2 Stufe 2: Auswertung der Informationsbedarfsanalyse . . . . . . . . . .. 200
8.9.3 Stufe 3: Ergebnisse der Informationsbedarfsanalyse ............ 201
8.10 Informationsdarstellung am Beispiel von Kennzahlen im Informatik-
bereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 203
8.10.1 Kennzahlcnermittlung.................................... 206
8.10.1.1 Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit .. . . . . . . . . . . . . . . .. 208
8.10.1.2 Kennzahlen zur Benutzerzufriedenheit . . . . . . . . . . . . . .. 218
8.10.1.3 Kennzahlen zur Flexibilitat ........................ 220
8.10.1.4 Kennzahlen zur Systemsichcrheit . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221
8.10.1.5 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen .................. 222
8.10.2 Kennzahlenaufbereitung.................................. 223
8.10.2.1 Symplex-Graphiken ............................. 223
8.10.2.2 Polardiagramme ................................ 234
8.10.2.3 Fazit.......................................... 235
8.10.3 Autbau und Nutzung eines Kennzahlensystems. . . . . . . . . . . . . . .. 236
8.11 Zusammenfassung............................................. 236
9. Organisation des nV-Controlling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239
9.1 Organisationstheoretische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239
9.1.1 Zusammenhang zwischen Autbau-und Ablauforganisation ...... 239
9.1.2 Organisationsformen..................................... 239
9.1.2.1 Die Linienorganisation ........................... 240
9.1.2.2 Die Stab-Linien-Organisation ...................... 241
9.1.2.3 Die funktionale Organisation ...................... 242
9.1.2.4 Die Matrix-Organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 243
9.1.2.5 Die Projektorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244
9.1.3 Gegeniiberstellung der einze1nen Organisationsformen . . . . . . . . .. 245
9.2 Aufbauorganisatorische Einordnung des DV-Controlling .............. 245
9.2.1 Zentralisierung versus Dezentralisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 245
x